Sondernewsletter E-Kerosin / Greenwashing

Sehr geehrte Damen und Herren,
im neuen Koalitionsvertrag der schwarz-roten Regierung wird Klimaschutz für die Luftfahrt neu ausgerichtet: „Unser Ziel ist es, die Modernisierung in der Luftfahrtindustrie in Richtung fairer Wettbewerb und Dekarbonisierung zu gestalten“, heißt es darin, und: „Die luftverkehrsspezifischen Steuern, Gebühren und Abgaben wollen wir reduzieren und die Erhöhung der Luftverkehrsteuer zurücknehmen.“
Wenn der gesetzliche Klimaschutz nachlässt und finanzielle Mittel für die Lösungen entfallen, liegt es zunehmend an Unternehmen und Privatpersonen, diese Lücke zu füllen, um die Klimaziele von Paris nicht ganz aufgeben zu müssen.
Deutsche Airline vor Gericht
Leider sieht es derzeit nicht danach aus: Mit der Lufthansa wurde gerade die größte deutsche Fluggesellschaft vom Landgericht Köln wegen irreführender Aussagen beim Klimaschutz verurteilt. Aber auch andere Airlines nehmen es bei der Klimainformation Ihrer Kunden nicht so genau, immerhin droht ja, dass sie sich damit ein Eigentor bei den kommenden internationalen Regulierungen schießen. Die reale und ungeschönte Klimabilanz von Flügen bleibt ein Schmerz- und Reizthema für die Branche. Lesen Sie mehr hier.
e-Kerosin kämpft mit technischen Schwierigkeiten
Noch größer wird die Lücke zwischen den Klimazielen von Paris und den erforderlichen Fortschritten bei einer zentralen Lösung für das Fliegen, nämlich strombasiertes power-to-liquid Kerosin (e-Kerosin oder PtL-Kerosin). Der neue Koalitionsvertrag sagt dazu: „Die über das EU-Maß hinausgehende Power to Liquid (PtL)-Quote schaffen wir sofort ab.“
Dabei wären positive Anreize gerade heute wichtiger denn je. Unsere eigene PtL-Anlage im Emsland funktioniert nach vier Jahren immer noch nicht annährend wie geplant, und unsere Hoffnungen auf funktionierende Produktion, mit denen wir im Sommer 2024 noch verhalten optimistisch waren, haben sich nicht bestätigt. In der Konsequenz müssen wir auch die atmosfair-Produkte ändern: Wenn Sie zukünftig bei atmosfair die CO₂-Emissionen Ihres Fluges kompensieren, können Sie zwar weiter die Produktion von CO₂-neutralem Kerosin fördern, aber eine bestimmte Menge versprechen wir nicht mehr. Lesen Sie mehr hier. Derzeit schauen wir uns alle Alternativen an, um Lösungen zu finden, inklusive Schritte gegen die Technologieanbieter.
Bei Vorträgen vor Fachpublikum im In- und Ausland bin ich manchmal überrascht, wie wenig Praxiswissen selbst bei Experten vorhanden ist. Beratungsfirmen malen unverdrossen Wachstumskurven für e-Kerosin auf, Forschungsprogramme an Universitäten und im Regierungsauftrag setzen funktionierende Technologie und Skalierung voraus. Dabei wird immer deutlicher, dass manche technologische Konzepte auf dem Weg vom Labor- zum Industriemaßstab stecken bleiben. Unserer Technologie im Emsland könnte es im schlimmsten Fall so ergehen wie in dem prominenten Fall von Choren aus den Nuller-Jahren im sächsischen Freiberg: Eine gehypte Zukunftstechnologie im Bereich der erneuerbaren synthetischen Kraftstoffe, mit viel Investorengeld auf einem Weg, der nach ein paar Jahren in die Insolvenz führt.
Aber es gibt auch gute Neuigkeiten: In einer großen Versuchsanlage in Wien haben wir erfolgreich weitere Fässer von Rohkerosin über die Gasifizierung von Abfallbiomassen produziert (Biomass to liquid, BtL). Die Anlage hat nominell das gleiche Produktionsvolumen wie unsere PtL-Anlage im Emsland, aber hier ist die Technologiereife deutlich höher. Jetzt sind wir dabei, mehrere Standorte in Ländern des globalen Südens zu prüfen, wo es genügend echte Reststoffe wie Holzschalen oder Klärschlamm gibt, um eine Produktionsanlage zu bauen.
Als gemeinnützige GmbH sind wir dem Klimaschutz und der Transparenz verpflichtet, auch wenn es nicht immer gute Nachrichten gibt. Aber der Weg ist gesetzt: Auch wenn große Synfuel-Projekte wie von Fulcrum in den USA scheitern und andere dauerhaft verschoben werden und nie in die Umsetzungsphase kommen: Den Kopf in den Sand zu stecken reicht nicht. Es mag nur ein schwacher Trost sein, dass keine andere Anlage erfolgreich e-Kerosin auf Industrieniveau produziert. Aber für den Flugverkehr auf der Mittel- und Langstrecke haben wir außer dem Verzicht leider keine Alternative.
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Vertrauen. Klimaschutz durch Aufbau von erneuerbaren Energien in Entwicklungsländern bleibt unsere Hauptaufgabe. Denn weiterhin sind in vielen Entwicklungsländern Menschen heute schon erheblich von der Klimaerwärmung betroffen, die sie nicht verursacht haben. Hier CO₂ zu mindern und dabei konkreten Nutzen für Menschen und Wirtschaft zu schaffen ist unser Weg. Deswegen machen wir weiter, auch wenn es manchmal schwierig ist.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung,
Ihr Dietrich Brockhagen
GF atmosfair
Lufthansa und co: Warum die Grünfärberei bei der CO₂-Berechnung?
Mit dem Urteil vom März 2025 hat das Landgericht Köln klargestellt, dass die Lufthansa in ihrem Kompensationsrechner Kunden ihrer Flüge nur einen Bruchteil der Klimawirkung ausweist und den größten Teil verschweigt; derjenige, der über die sogenannten Non-CO₂-Emissionen entsteht.
Erstaunlich, dass es fast 20 Jahre dauern musste, bevor ein Gericht dies festgestellt hat. Schon 2008 berichteten Zeitungen, wie die Lufthansa bei der Auswahl ihres Kompensationsanbieters atmosfair ablehnte, weil atmosfair die volle Klimawirkung von Flügen darstellte, der gewählte Anbieter MyClimate aus der Schweiz aber nicht.
Denn die Wissenschaft ist hier seit Jahrzehnten klar: Non-CO₂ Emissionen wie z.B. Stickoxide, Schwefelverbindungen oder Ruß entstehen im Flugzeugtriebwerk und verursachen in großen Flughöhen Effekte wie den Aufbau von Ozon, Abbau von Methan, Bildung von Kondensstreifen und Schleierwolken. Seit den 1990er Jahren werden diese intensiv erforscht; das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR gehörte und gehört hierbei zu den international führenden Instituten.
Quantifiziert wurden die Effekte schon früh. 1996 schätze Greenpeace, dass der Flugverkehr durch die Non-CO₂-Emissionen insgesamt dreimal klimaschädlicher ist als durch seine CO₂-Emissionen allein. 1999 entwickelte der wissenschaftliche Weltklimarat IPCC eine neue Maßeinheit für Non-CO₂ Effekte des Luftverkehrs und bezifferte den Faktor der erhöhten Klimawirksamkeit durch Non-CO₂ gegenüber dem reinen CO₂ auf 2-4. Seitdem hat sich die Forschung ständig weiterentwickelt, einige Effekte wurden neu, einige abgeschwächt andere verstärkt, aber alle immer genauer bestimmt. Heute sind wir so weit, dass nicht mehr die verbleibenden Restunsicherheiten der physischen Effekte wie optische Dichte von Kondensstreifen oder Strahlungsantrieb durch Ozonbildung in der unteren Stratosphäre diesen Faktor für Non-CO₂ bestimmen, sondern der von außen angesetzte Rahmen: Bestimme ich die Klimawirksamkeit für die nächsten 20, 50 oder 100 Jahre? Messe ich die Klimawirkung durch die Erwärmung am Boden oder den Strahlungsfluss der Energie in der Atmosphäre? Hervorragend und leicht verständlich zusammengefasst hat den Wissenstand und seine Bedeutung die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz in einer Publikation von 2021.
Nun ist die Lufthansa nicht die einzige deutsche oder internationale Airline, die die Klimawirkung ihrer Flüge seit vielen Jahren viel zu niedrig angibt.
Warum das so ist, wird klar, wenn wir zurück ins Jahr 2022 schauen: Damals verpflichtete das EU-Parlament die EU-Kommission, bis Ende 2026 einen Vorschlag vorzulegen, wie die Non-CO₂-Emissionen in den verpflichtenden EU-Emissionshandel für Airlines einbezogen werden können. Solange dieser Vorschlag der EU-Kommission nicht in Recht umgesetzt ist, sollen ab 2028 Non-CO₂-Emissionen mit einfachen Aufschlagfaktoren auf die reinen CO₂ Emissionen in das EU-Emissionshandelssystem eingehen. Ab 2025 greift bereits ein Mess- und Berichtssystem für Non-CO₂-Emissionen in der EU.
Damit ist klar, dass Non-CO₂ für Airlines bald teuer wird: Im verpflichtenden Emissionshandel mal eben das dreifache für das Klima zu bezahlen wie bisher ist keine Nachricht, bei der Airlines jubeln dürften.
Die Airline Lobby blieb nicht untätig: Willie Walsh, Chef des Weltluftverbands IATA, wandte sich 2024 an die EU-Kommission, mit der Bitte, das neue Berichtssystem von verpflichtend auf freiwillig umzustellen. Denn, natürlich, die Wissenschaft sei noch nicht so weit; außerdem gäbe es rechtliche Bedenken, wenn die EU auch Airlines aus dem Ausland zur Kasse bäte.
Abgesehen davon, dass der Gerichtshof der EU in dieser Sache schon grünes Licht gegeben hat, und dass Wissenschaft und Politik mit immer verbleibenden Restunsicherheiten wie bei Anti-Rauchwerbung auf Zigarettenpackungen sicher umgehen können: Walsh und seine IATA zeigen, dass das Thema Non-CO₂ für Airlines wegen der kommenden Gesetzgebung so heikel ist, dass darunter selbst der eigentlich unschuldige freiwillige Klimaschutz leidet: Keine Airline gibt heute die freiwillige CO₂-Kompensatzion mit korrekter Klimabilanz an, denn damit senkt sie ihre Aussichten drastisch, in den kommenden Gesetzgebungs- und damit Lobbyprozessen auch nur halbwegs glaubhaft die angeblichen Wissenschaftslücken zu bemühen.
Was heißt das für uns? atmosfair berechnet auf seiner Website die CO₂- und Non-CO₂ Emissionen nach dem Stand der Wissenschaft und damit um ein Vielfaches höher als die Lufthansa oder andere deutsche und internationale Airlines. Klar, dass uns damit bei der oben genannten politischen Großwetterlage keine Airline als Kompensationsanbieter auswählt.
Aber wir sind als gemeinnützige Organisation in erster Linie dem Klimaschutz verpflichtet und nicht der Maximierung von Einnahmen. Langfristig können wir im Klimaschutz aber nur gewinnen, wenn die Preise die ökologische Wahrheit sagen. Und daher ist es uns und unseren Schirmherren wichtiger, sauber zu rechnen, anstatt auf niedrigen Trittbrettern mitzufahren. atmosfair Schirmherr Prof. Klaus Töpfer, der letztes Jahr verstarb, hatte im Jahre 2008 die Entscheidung gegen Lufthansa mitgetragen, obwohl sich in der damaligen Aufbauzeit atmosfair damit viele Türen verschlossen. Er brachte es damals auf den Punkt: „Reden müssen wir immer. Aber mitmachen können wir da nicht.“
Grünes Kerosin: Pilotanlage im Emsland kämpft mit Power to Liquid Technik
Im Sommer 2024 waren wir noch verhalten optimistisch: Wir konnten der Presse melden, dass unsere Anlage seit der Eröffnung im Jahr 2021 in vier Jahren insgesamt 5 Tonnen synthetisches Rohkerosin produziert hatte. Das war zwar deutlich weniger als die bei der Eröffnung noch geplanten 300 Tonnen jährlich, aber die ersten Schritte sind ja bekanntlich immer die schwersten. „Die Technologie ist noch nicht reif und muss für den Hochlauf erst noch zeigen, dass sie wichtige Hürden nehmen kann“ sagten wir vor einem Jahr öffentlich. Uns war bewusst, dass die Anlage bis dahin hauptsächlich in einem vereinfachten Betriebsmodus lief und der eigentliche Modus erst noch kommen sollte. Dazu kam, dass sich im Rahmen der Testbetankungen zeigte, dass Raffinerien das Rohkerosin nicht annahmen, da es außerhalb der notwendigen Spezifikationen lag. Dabei nutzen wir in Werlte Wasserstoff auf Industriestandard als Feedstock und hatten zudem nach anfänglicher hoher Schwefelbelastung im Abgas der Biogasanlage schon vor dem Sommer 2024 auf industrielles CO₂ mit Lebensmittelqualität umgestellt und Ausfallzeiten der Anlagenperipherie auf wenige Tage im Jahr reduziert, so dass wichtige Fehlerquellen ausgeschlossen sind.
Ein knappes Jahr später sieht es im Frühjahr 2025 leider kaum besser aus. Es ist kaum Rohkerosin dazugekommen, und der echte Betriebsmodus bleibt weiter eine Herausforderung.
Nun ist unsere Anlage nicht die Einzige, die Probleme hat. Auch in Hamburg steht bei einer Raffinerie eine Anlage mit identischer Technologie, von der bisher keine Produktionsmengen gemeldet wurden.
Derzeit wägen wir Optionen für nächste Schritte ab: Dies kann die Umstellung unserer PtL-Anlage im Emsland auf eine neue Erzeugungsroute sein (Gas to Liquid über Plasmalyse von Biogas), aber auch die Einleitung von rechtlichen Schritten gegen unseren Technologielieferanten. Wir haben einen langen Atem und Verständnis für junge Technologien, verlangen gleichwohl von unserem Technologiepartner die Übernahme von seinem Teil der Verantwortung. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob wir unsere diesbezüglichen Ansprüche gerichtlich durchsetzen müssen.
An dem grundsätzlichen Auftrag und Kurs von atmosfair ändert sich dadurch aber nichts: Wir bauen weiter Pilotanlagen, wo Technologien noch neu sind, um sie in Entwicklungsländern zu verbreiten. Dies gilt für Photovoltaik mit Batterien und kleinen Inselstromnetzen für Dörfer, Waste to Energy Anlagen für Strom und Biogas aus Mülldeponien, Produktion von Pflanzenkohle per Pyrolyse mit gleichzeitiger Stromerzeugung und weiteren neuen oder noch wenig erprobten Konzepten. Und gerade bei der Produktion von grünem Kerosin haben viele Entwicklungsländer Standortvorteile: Insbesondere das strombasierte Kerosin hat wegen der hohen Sonneneinstrahlung und damit Photovoltaik-Potential in vielen Entwicklungsländern im Sonnengürtel der Erde prinzipiell und langfristig gute Chancen, sowohl den Klimaschutz als auch die wirtschaftliche Entwicklung der Länder zu unterstützen.


 Teilen
Teilen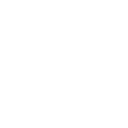 Twittern
Twittern